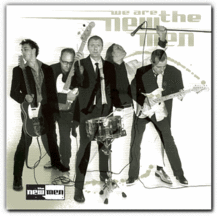Nachhaltige Performance - oder Wie man den Hofnarr spielt für den König Markt
Eigentlich hätte ich es besser wissen sollen: Das Schicksal, das einen Aussenseiter an einer Zusammenkunft von Theaterfans zu erwarten hat, ist bereits im fünften Jahrhundert von Aristophanes, dem Dichter aus Athen, dramatisiert worden. Während der 90er Jahre habe ich einige meiner kostbaren Jugendjahre seinem Studium gewidmet. Ich versuchte, damals eine Theorie aufzustellen, die beweisen sollte, dass sozialkritische Komödien in der Tendenz ihre revolutionäre Sprengkraft von derselben Macht vereinnahmen lassen, die sie vordergründig stürzen wollten. (1) In Aristophanes Komödie Thesmophoriazusae (dt. Die Thesmophorienfeier) versucht jedenfalls der Tragödiendichter Euripides eine Gruppe von Frauen auszuhorchen, die sich zusammengefunden hat, um das vom Dramatiker entworfene, skandalöse Frauenbild zu diskutieren. Als EuripidesÂ’ spionierender Transvestit entdeckt wird, kann er dem Tod – er soll wilden Tieren zum Frass vorgeworfen werden - nur knapp entkommen, indem er einige ziemlich weit hergeholte Theatertricks hervorzaubert, bei denen auch ein Weinschlauch und eine Tänzerin eine Rolle spielen.
Dennoch habe ich ohne zu zögern zugesagt, als mich Beat Mazenauer und Adi Blum anfragten, ob ich am IETM-Meeting in Zürich als Beobachter teilnehmen wolle (zusammen mit Anna Kim aus Österreich und Daniel de Roulet aus der französischen Schweiz). Eine Vorsichtsmassnahme habe ich jedoch getroffen: Als ich meine Beobachterkollegen am Vorabend des Meetings traf, um mit ihnen auszuhandeln, wer welchen der drei thematischen Stränge des Meetings übernehmen solle, wählte ich nicht „Kunst“ und „Politik“ sondern „Wirtschaft“. Ich stellte mir vor, dass es bei der Diskussion über die wirtschaftliche Bedeutung von Kunst in einer freien Demokratie weniger wahrscheinlich sein sollte, dass plötzlich in einem unbedachten kritischen Moment der innere Kreis der Diskutanten über den Eindringling herfallen würde, um ihn bildlich den Hunden zu verfüttern.
Als die Konferenz am Freitag Morgen in Fahrt kam, schienen sich meine Vorahnungen wirklich zu bestätigen. Am Vorabend war das Meeting mit einem Empfang im Stadthaus von Zürich eröffnet worden. Der Stadtpräsident von Zürich, zuerst alle Abgesandten begrüssend, hatte in seiner Rede mit Mühe und Not alle wirtschaftlichen Themen umschifft, indem er stolz auf die ganz frisch gefällte Entscheidung der lokalen Wählerschaft verwies, dem Cabaret Voltaire, dem „Geburtshaus des Dadaismus“, weiterhin finanzielle Unterstützung zu gewähren, was fraglich geworden war, als die Hausbesitzerin, eine Versicherungsgesellschaft, vor nicht langer Zeit angekündigt hatte, den Ort für eigene (kulturlos) betriebliche Zwecke nutzen zu wollen. Als diese Pläne von militanten Hausbesetzern im Keim erstickt worden waren, schritt die Stadt ein, nun wird sie mit dem frischen Abstimmungsergebnis im Rücken in Zukunft die Miete für dieses „Museum mit Nachtclub“ bezahlen. Stadtpräsident Ledergerber schien folgendes mitteilen zu wollen: Zürich ist ein Ort, wo die Kunst nicht nur mit bürgerlichen Lippenbekenntnissen abgespiesen, sondern mit gültiger Währung anerkannt wird, und dies auch zu einer Zeit, in welcher „öffentliche Gelder“ gänzlich in die entgegengesetzte Richtung, in den „privaten Sektor“, fliessen. So konnten sich die Anwesenden, ohne sich ein schlechtes Gewissen zu machen, entspannen, die Alltagssorgen vergessen und sich auf eine Konferenz freuen, an der sie beruhigt über die weniger weltlichen Anliegen ihrer Zunft nachdenken konnten.
Als nun am Freitag morgen die IETM-Generalsekretärin Mary Ann de Vlieg in der Plenarsitzung den Startschuss gab, die Frage in den Raum stellend, ob die aktuelle Finanzkrise vielleicht“nur ein weiteres globales Missverständnis” sei, da wiegte ich mich noch immer in einem falschen Gefühl der Sicherheit. Ich glaubte, ich hätte den mir vertrauten akademischen Tonfall der Ostküste im Ohr, dem Ort, wo ich einen grossen Teil meiner Zeit mit dem Studium von ökonomischen Allegorien in antiken Komödien verbracht habe. Und ich war mir gewiss, hier unter Kollegen konnte ich mich sicher fühlen, notabene alles universitäre Ironiker, die für gewöhnlich die “Realwirtschaft” mit einem ÂŽižekschen Paradox in die Wüste schicken, um sich dann schnell wieder ihrer clever angepassten Geschichte des deutschen Idealismus zuzuwenden. Ich freute mich auf ein Wochenende, an welchem einem beim Entwickeln von Thesen zur Ökonomie der Performing Arts und zur Performance der Ökonomie à la Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte die Zeit schnell vergeht.
Die nächsten Worte aus dem Mund von Mary Ann liessen mich jedoch von meinem Sitz hochfahren: die Generalsekretärin machte überhaupt keine Anstalten, die Krise und ihre möglichen Auswirkungen auf den Kunstbereich links liegen zu lassen, sie zitierte Naomi Klein, die beharrliche und eigensinnige kanadische Kritikerin des globalen Imperialismus der Grosskonzerne. Sie war es, die kürzlich darauf hingewiesen hatte, dass der Kapitalismus aus der gegenwärtigen Krise durchaus gefestigt hervorgehen könne. Und als ich dann erfuhr, dass Mary Ann aus Detroit stammt, aus der AKA Motor City, aus der einzigen Grossmetropole der 48 Staaten des nordamerikanischen Kontinents, die sich nördlich meiner kanadischen Heimat befindet – und sich so den Respekt meiner Frost gewohnten Landsleute verdient – wusste ich, dass die „Realwirtschaft“ während der kommenden Sitzungen durchaus als Thema präsent sein würde. Als ich das Gebäude verliess, in welchem die Plenarsitzung stattgefunden hatte, sah ich, dass wir uns in der alten Handelskammer Zürichs, deren Räume heute für öffentliche Diskotheken und Konzerte benutzt werden, zusammengefunden hatten. Für eine praxisnahe Verknüpfung von Markt und Kunst hätte ich mir kaum einen anschaulicheren Beweis wünschen können.
Das Wort „chinesisch“ in “Klingt für mich chinesisch – oder Wie begegne ich einer anderen Welt”, dem Titel der ersten der drei Sitzungen zum Thema Wirtschaft, ist mehrdeutig. Es kann sowohl sprichwörtlich als Bild für eine (aus einer westlichen Perspektive) kulturelle Opazität gelesen werden, aber es ist auch eine Metonymie für jene „aufstrebenden“ Wirtschaften, die die sogenannte „erste“ Welt in der Regel mit ganz gemischten Gefühlen wahrnimmt. (Ich erinnere mich an die Aussage einer CEO eines mittelgrossen Schweizer Unternehmens, als sie von ihren Plänen sprach, einen Teil der Dienstleistungen der Unternehmung von Anbietern in den BRIC Ländern hin zu den vorwiegend westeuropäischen Kunden zu „outsourcen“. Als sie darauf gefragt wurde, welche Länder sie damit meine, erklärte sie den Begriff als ein Akronym der Landesnamen Brasilien, Russland, Indien und China: Sie meinte damit also jene Staaten, die auf Grund ihrer intermediären oder hybriden Position nur dieser speziellen Zugehörigkeitsgruppe zugeordnet werden können.)
Die Unternehmer von heute, egal ob sie in der Wirtschaft oder in der Kunst aktiv sind, müssen den neuen Realitäten der Globalisierung Rechnung tragen. Insbesondere müssen sie das wachsende Bedürfnis anerkennen, dass ausländische Partner (wie zum Beispiel China) nicht mehr einfach nur mit einem oberflächlichen Reiseführer-Verständnis der lokalen Gebräuche abgespiesen werden können, sondern dass sie im Rahmen einer erweiterten Idee von Multikulturalismus gesehen werden müssen, einem Konzept, das die eigene Identität nicht mehr als den einen neutralen Nullpunkt definiert, von wo aus alle anderen gemessen werden. Eva Lüdi Kong, die schon seit langem in China wohnt, erzählte über ihre Ankunft in Hangzhou als Schweizer Studentin in den früher 90ern. Sie wurde damals mit der Tatsache konfrontiert, dass Chinesen alle Nicht-Chinesen pauschal als Leute aus dem Westen wahrnahmen, und sie erlebte unter dem Druck, sich assimilieren zu müssen, aus erster Hand den Verlust ihrer eigenen kulturellen Kodierungen. Pascale Reinhardt, eine Psychologin aus Frankreich, die auch in China gelebt hatte, berichtete von ihren Erfahrungen als „Ei“ (als Frau aus dem Westen mit asiatischem „Kern“) unter „Bananen“ (Asiaten mit westlichem „Kern“) und fasste die Ost-West-Beziehungen, wie sie sich seit den 90er Jahren entwickelt haben, in einer drastischen Formel zusammen: die aalglatte Aufteilung in „Zielkulturen„ und „Nicht-Zielkulturen“. Dies lege die „postnationale“ Segmentierung der Märkte als Funktion der Globalisierung offen und zeige, dass der heutige ökonomische Imperialismus nichts anderes als ein Abkömmling der Kanonenbootdiplomatie des goldenen Zeitalters des Kolonialismus sei.
In der anschliessenden Diskussion wurden die Podiumsteilnehmer nach Anekdoten gefragt. Sie wurden gebeten, von ihren persönlichen Erfahrungen im kulturellen Brückenbau zu erzählen. Die Kanadierin Sharon Fernandez, eine kanadische Fachfrau in kulturpolitischen Fragen, legte dar, dass die kulturelle Vielfalt im ganzen Kunstbereich mittlerweile ein gängiger Begriff geworden sei und sie strich heraus, dass die Reibung, die bei interkulturellen Kontakten entstehen könne, immer positive Wirkungen zeitige, während Sandro Lunin, der künstlerische Leiter des Zürcher Theaterspektakels, von seiner Arbeit in Afrika berichtete, wo er zur Zeit ein kulturelles Netzwerk aufbaut, und dabei bemerke, wie wichtig das Engagement der Schweiz in diesem Bereich sei in Anbetracht einer beschämenden Vorgeschichte: Die Schweiz unterstützte jahrzehntelang das Apartheidregime in Südafrika. Lüdi Kong beschrieb die unterschiedlichen Herangehensweisen von Chinesen und Deutschen bei Gesprächseröffnungen: Während ein Deutscher, so ihre Beobachtung, eher direkt zur Sache kommen will, indem er den impliziten Sinn einer gegebenen Situation zur Sprache bringt, zieht es ein Chinese vor, sich indirekt dem Gesprächsgegenstand zu nähern, und es kann durchaus vorkommen, dass er auf eine ungeheuerlich politisch inkorrekte Weise Witze über Tabuthemen macht, nur um eingangs die Aufmerksamkeit abzulenken. (Sie machte ein Beispiel aus dem Repertoire von Entgegnungen: ein Chinese, von einem Ausländer nach der Todesstrafe in China gefragt, entgegnet: „Es gibt eh zu viele Chinesen!“) Reinhard ihrerseits zeigte auf, was für Ungemach auf einen Westler, der in Südostasien Geschäfte machen will, aber keine Ahnung von den relevanten kulturellen Kodierungen hat, zukommt. Sie betonte, dass auch eine effiziente Liste mit ‚dosÂ’ und ‚donÂ’tsÂ’ nicht zum Ziel führt, und empfahl Menschen aus dem Westen, einen Sinn für die eigene Fremdheit in einem fremden Land, aber auch für die möglichen Gemeinsamkeiten zu entwickeln: die Vorliebe der Franzosen, gerne bereits beim Verhandlungsbeginn „nein“ zu sagen, sei weniger Ausdruck einer unüberwindbaren Differenz, sondern mehr ein Fingerzeig dafür, dass der Sprecher erst weitere Informationen benötigt, um eine Vereinbarung treffen zu können; somit sei er gar nicht weit von der chinesischen Gewohnheit der indirekten Gesprächseröffnung entfernt.
Zum Abschluss der Sitzung ging die Frage an die Runde, wie die darstellenden Künste „dem Rest der Welt” – da war wohl die Welt jenseits der amerikanischen und europäischen Grenzen gemeint – einen Nutzen bringen könnten. Und seltsamerweise genau hier, wo das Podium die wohl am unklarsten formulierte Frage – und dennoch war es wohl die klassisch humanistischste der Veranstaltung – beantworten sollte, waren plötzlich die schärfsten Töne zu hören. Während Fernandez und Lunin praktische Beispiele von politischem Aktivismus der Künstlerschaft in der karibischen Diaspora und im Nahen Osten anführten, und Lüdi Kong die letztlich positive Wirkung der Präsenz von ausländischen Beobachtern in China in den 80er Jahren hervorstrich, welche die Kunst der Avant-Garde als zwangsläufig regimekritisch interpretierten und so den Boden für die derzeitige Fülle von interkulturellen Kooperationen bereiteten, riss Reinhardts Bericht über ihre Arbeit mit marginalisierten Gemeinschaften eine Publikumsdebatte über das Konfliktpotential von politisch motivierter Kunstförderung vom Zaun. Die Sitzung liess mich mit gemischten Gefühlen zurück. Mir waren die Bemerkungen des britischen Abgesandten über die einschlägigen „asiatischen und jüdischen Gemeinschaften“ mit ihrer ominösen finanziellen Einflussnahme auf lokale Künstler noch in den Ohren. Schattierungen einer internationalen zionistischen Verschwörung sollen mittelmässige und tendenziöse Kunst finanzieren!
Gestärkt durch Stefan Puchers hervorragende Produktion von AeschylusÂ’ „Die Perser“, die einzige griechische Tragödie, die nicht ein mythologischen Thema, sondern zeitgenössische Historie verhandelt, nahm ich am nächsten Morgen in der zweiten IETM-Sitzung Platz. Sie sollte sich auf die Schnittstellen von Wirtschaft und Kunst konzentrieren und die Missverständnisse benennen, die bei solchen Begegnungen entstehen. Die doch eher traditionelle Beschreibung der Organisatoren, die die gegensätzlichen Interessen von Kunst und Wirtschaft hervorstrich – Kunst ist autonom und anarchisch, Wirtschaft auf Gewinn aus und marktorientiert – und ihr zaghafter Verweis auf eine Hegelianische Aufhebung der Differenz („Sind Künstler nicht auch freie Unternehmer?“) liessen mich an Jane Jacobs, die aktuelle Wortführerin Kanadas in Sachen Städteplanung und ihren durch „Systems of Survival“ (einem zeitgemässen platonischen Dialog) eingeleiteten Paradigmenwechsel denken. (2) In „Systems of Survival“ inszeniert Jacobs unter Vertretern von verschiedenen bürgerlichen Berufsständen eine lockere Debatte über die vermeintliche moralische Unvereinbarkeit von Wirtschaft und Politik und über die ethischen Risiken, die eine Vermischung der zwei Bereiche mit sich bringt. Im Verlauf dieser Debatte stellt einer der Protagonisten eine verrückte Theorie auf. Die Kunst sei entstanden als eine Reaktion auf die Bedrohung durch erschöpfte Ressourcen, mit welcher die prähistorischen Jäger und Sammler konfrontiert waren. Um das Überjagen zu verhindern, schlägt der Sprecher vor, erfanden die Naturvölker die Kunst, einschliesslich der darstellenden Künste und der Musik. Damit konnten sie die Möchtegern-Jäger in Zeiten, in denen sich der Bestand ihrer Wildtiere regenerieren musste, vom Jagen ablenken. So betrachtet sind Kunst und Wirtschaft – hier allgemein als Aufgabe verstanden, menschliche Bedürfnisse durch Arbeitsteilung und Handel zu befriedigen – nicht gegenläufige sondern sich ergänzende Bereiche, die in einer empfindlichen Symbiose existieren, in der jeweils der eine den Mangel des anderen ausgleicht. Während die Wirtschaft den für das menschliche Leben notwendigen Unterhalt erzeugt (deshalb im ursprünglichen Sinn Kultur ist), bietet die Kunst eine sinnvolle Betätigung für die (Frei-)Zeit, die für das Aufstocken der lebensnotwendigen Ressourcen notwendig ist.
Die Podiumsteilnehmer verfolgten an diesem Morgen tatsächlich einen ähnlichen Kurs und beschrieben eine zeitgenössische Kunstwelt, die zunehmend in Übereinstimmung mit einem solchen synergetischen Modell funktioniert und sich nicht mehr automatisch dem antimaterialistischen Diktat der 68er beugt. Die jungen Künstler von heute ahmen jene Unternehmer nach, die von der vorherigen Generation verschmäht worden sind. Sie eignen sich ganz pragmatische (um nicht zu sagen prosaische) Fähigkeiten an wie das Schreiben von Bewerbungen und das Hofieren von potentiellen Sponsoren aus der Wirtschaft. Das Phänomen ist international. Es gilt mitzuhalten mit der Liberalisierung der „Realwirtschaft“, wir nennen sie Globalisierung. Podiumsgast Hans Abbing, praktizierender Künstler und auch ausgebildeter Ökonom, wies darauf hin, das sein Buch „Why Are Artists Poor?“ nun auch in Japan und Korea erhältlich sei. Dort konnten Künstler noch bis vor kurzem mit der Unterstützung der öffentlichen Hand rechnen, und die romantische Figur des hungernden Künstler war praktisch unbekannt. (3) Abbings Buch, 2002 mit dem Untertitel „The Exceptional Economy of the Arts“ veröffentlicht, befasst sich explizit mit den Problemen, die aus der herkömmlichen Dichotomie von Kunst und Wirtschaft als zwei unversöhnlichen Gegensätzen im Bezug auf ihren Nutzen entstehen. „Kunst als etwas Heiliges steht im Widerspruch zur Idee von kalkulierbarem Handel mit Geld“, schreibt er. „Obwohl die Kunst etwa die Hälfte ihres Einkommens auf dem Markt verdient, kann sie ihren Status als etwas Heiliges nur aufrecht erhalten, wenn die Menschen sie mit den Werten einer Kultur des Schenkens und nicht einer Kultur des Vermarktens in Verbindung bringen. Dieser Status bedingt eine Ablehnung der Ökonomie.” (4)
Während die zwei anderen Podiumsgäste Katrin Kolo and Christoph Weckerle aus ihrer Arbeitspraxis an der Schnittstelle von Kunst und Wirtschaft (als professionelle Choreographin, respektive als Dozent und Experte für kulturpolitische Fragen) berichteten, und dabei die Ansicht vertraten, dass das kulturelle Kapital eines Künstlers auch Basis für sein finanzielles Kapital sein müsse, und dass Ängste vor einer privatisierten Kunstförderung nicht angezeigt seien, waren die Kommentatoren aus dem Publikum weniger zuversichtlich hinsichtlich der fortschreitenden Liberalisierung der Kunstwelt. Die Palette der geäusserten Kritik reichte vom Praktischen („Führt das am besten formulierte Finanzgesuch notwendigerweise auch zur besten Kunst?“) bis zum Theoretischen (ein Abgesandter kam auf jenen gängigen soziologischen Topos zu sprechen, der die Risiken beschreibt, wenn ein Geschenk zur Handelsware wird, das Geschenk in einem dekonstruktiven Sinn verstanden als ein ungewöhnliches, aber notwendiges Element in einer Gesellschaft, die ansonsten auf Handel baut). Jene Teilnehmer, die keine Probleme damit bekundeten, die Kunstwelt als einen zunehmend vom privaten Sektor abhängigen Bereich zu sehen, und die als Künstler selber schon bei einer „Professionalisierung“ der Bemühungen um Unterstützung durch Grossbetriebe mitmachten, gingen jetzt mit einem sozialutopischen Vorbehalt auf Nummer sicher: Wenn künstlerische Produkte über den Markt vertrieben werden sollen, so wurde im Publikum argumentiert, und wenn der Stand der Ausbildung bestimmend ist, welches Produkt zu Ungunsten eines anderen gewählt wird (bei der Wahl eines nichtkünstlerischen Produkts wie zum Beispiel Zahnpasta hat die Schulbildung keinen Einfluss), dann muss das gesamte Schulsystem überholt werden. Junge Bürger sollen nicht nur lernen, wie mit einem Scheckbuch umzugehen ist, und was sie an ihrem nationalen Feiertag singen müssen, sondern auch, wie man unterscheidet, was wirkliche Kunst und was billiges kitschiges Imitat ist.
Dass Abbing mit einer gewissen Skepsis auf diesen Vorschlag einer quasi Re-Sakralisierung der Kunstwelt reagierte, muss hier nicht erwähnt werden, aber er erwähnte seinerseits die mit der aktuellen Garde junger Künstler gemachten Erfahrungen, die sowohl am Verhandlungstisch als auch bezüglich der Koordination ihrer Brotberufe, jenen Berufen, die ihnen genügend Zeit für die schöpferische Arbeit lassen, bewundernswert nüchternen Menschenverstand bewiesen. Er erwähnte eine ältere Generation von europäischen Künstlern, die in der Nachkriegszeit von einem boomenden Akademiker- und Beratermarkt profitieren konnten und die heute ihren „Brotjob“ oft als packender und erfüllender (um nicht zu sagen finanziell lohnender) als ihre Künstlerkarriere einschätzen und deshalb womöglich ganz von einem unorthodoxen Künstlerleben fortgelockt worden sind. Am Schluss herrschte bei den Podiumsteilnehmern und einigen der weniger idealistischen Zuhörer Übereinstimmung darin, dass die aktuelle Kunstwelt immer mehr auf eine vermittelnde Klasse von Agenten, Beratern und Kommunikationsexperten angewiesen ist, die den Berufskünstlern bei der Mittelbeschaffung bei Stiftungen, Firmen und auch, obwohl weniger als früher, im öffentlichen Sektor zur Hand geht. Als die Sitzung dem Ende zusteuerte, fiel mir plötzlich ein, dass nun, wo eine Regierung nach der anderen Steuergelder einsetzt, um dem privaten Sektor aus der Patsche zu helfen, die wirkliche Herkunft der Gelder, die von den Sponsoringabteilungen der Grossbetriebe eingesetzt werden, vollkommen unklar ist.
In der dritten und letzten Sitzung über ökonomische Missverständnisse, die als eine offene Diskussion über die Bedeutung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft angelegt war, kam Hans Abbing auf Themen der vorhergegangenen Podiumsdiskussion zurück. Die These lautete „Nur zu viel Kunst ist genug Kunst“. Während im 19. Jahrhundert und während der Hochblüte der klassischen Moderne Akademien die Kunstproduktion kontrollierten, sie beglaubigten nur eine beschränkte Anzahl von praktizierenden Künstlern, so erlebte die individualistische, rebellische zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts einen wahrhaften Künstlerboom, der die Forderung von Joseph Beuys, „jeder ist ein Künstler“, zu bestätigten schien. Die Nachfrage kann jedoch nicht immer mit dem Angebot Schritt halten, und so müssen die aufstrebenden Künstler heute, so Abbing, bereits früh einen Plan B in Betracht ziehen. Sie müssen wissen, wie zu ihrem einfach beschaffbaren Sozial- und Kulturkapital ökonomisches Kapital hinzukommt. Eine Alternative ist, wie bereits in der früheren Sitzung vorgeschlagen, die Nachfrage nach Kunst durch ein verändertes Schulsystem zu erhöhen, ein Keynesianischer Lösungsansatz gegen die erwartete Baisse bei den Künstlervermögen, die durch die wachsende Rezession entstanden ist. Er hat aber einen entscheidenden Makel: die Mittel, die benötigt werden, um das Schulsystem eines Landes anzupassen (wohl besser zu überholen), sind exakt jene Mittel, die nun auf Grund der Wirtschaftsrezession knapp sind.
So besteht dann die einzige Hoffnung, und die Anwesenden schienen sich darin einer Meinung zu sein, dass der private Sektor, der in den letzten Jahren fast nur als getarnte öffentliche Hand aufgetreten ist (oder ist es gerade umgekehrt?), den Nutzen (das heisst die Rentabilität) der Kunst für die eigenen unternehmerischen Zwecke erkennt und einen entscheidenden Schritt macht, indem er seine Politik der Kunstunterstützung ändert und vom Sponsoring zum Investieren übergeht. Dies würde eine langfristige und finanzstarke Unterstützung garantieren. Jedoch könnte sich ein solcher Schritt letztendlich verheerend auswirken – für die Kunst notabene. Sie muss dann mit der sehr realen Gefahr leben, dass sie plötzlich nach einer militärisch-industriellen Pfeife tanzen muss. Denn wer bezahlt, der befiehlt.
Tan Wälchli, ein Kulturtheoretiker aus der Schweiz, hat sehr spannend über den Konnex Kunst-Wirtschaft geschrieben, dies vor allem im Bezug auf die aktuelle Renaissance der Kunstperformance. (5) „Die momentane Beliebtheit der Performance,“ schreibt Wälchli, „beschränkt sich keineswegs auf den Kunstbereich: sie ist auch ein Leitbegriff des Kapitalismus, der von der ‚PerformanceÂ’ einer Aktie, einer Firma, eines Produkts oder – tatsächlich - eines Mitarbeiters spricht.“ Diese Verwandtschaft wirkt auf den ersten Blick irritierend. Wälchli schreibt, aus dem Werk der Philosophin Judith Butler zitierend: „Die Kunstperformance scheint der Beliebtheit der Performance als ein kapitalistischer Leitsatz diametral entgegengesetzt zu sein. Er zieht gesellschaftliche Grenzen und definiert jene Ordnung, die sein Gegenspieler durch Kunst zu untergraben sucht.“ Und doch, wie Butler selber argumentiert, „Performance als Subversion kann ziemlich gut funktionieren, obwohl die gesellschaftliche Ordnung selber auf Performance beruht.“
Anders ausgedrückt, obwohl sich die Zielobjekte der subversiven Kunstperformance der Theatralität der eigenen „Performance“ – als Direktoren, als politische Führungspersönlichkeit oder als Herrscher - durchaus bewusst sein können, liegt die eigentliche Macht der Kunstperformance darin, dass sie ihnen als Angehörige von traditionellen hegemonischen Systemen die völlige Zufälligkeit dieser Konstrukte vor Augen führt: „Indem die Kunstperformance sich selber inszeniert,“ schreibt Wälchli, „zeigt sie auf, dass unsere ‚normaleÂ’ Ordnung eigentlich eine Welt der Illusionen ist, eine Theaterbühne, auf der wir uns ständig spielen. Der Ausnahmezustand, durch welchen die Kunstperformance gesellschaftliche Konventionen temporär unterhöhlt, dient dazu, die Konstruiertheit dieser Konventionen zu veranschaulichen. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaftsordnung als eine Farce zu entlarven, und sie bietet folglich einen nahezu unendlichen Raum für das Erfinden eines Selbst als ‚WirtÂ’ für performative Identitäten, dies trotz fehlender Anerkennung dieses Vorgangs von offizieller Seite.“
Künstler müssen in diesem Sinne bei der Beschaffung der finanziellen Mittel, die sie für ihre Arbeit brauchen, ein anspruchsvolles Doppelspiel spielen: Während sie auf der einen Seite Sponsoren überzeugen müssen, dass künstlerische Kreativität und betriebswirtschaftliche Tugenden wie Managementfähigkeiten, stromlinienförmige Produktivität und Kostenwirksamkeit durchaus zusammengehen, müssen sie auf der anderen Seite vermeiden, den Verlockungen des wirtschaftlichen Erfolgs zu erliegen und so die eigene kritische Schärfe und das objektive Urteilsvermögen einzubüssen. „Auch jene, die für ihren Erfolg als Künstler mit Rang und Prestige belohnt werden,“ folgert Wälchli, „hören nicht auf, ein grundlegendes Misstrauen gegenüber jener Gesellschaftsordnung zu hegen, welche ihnen zu ihrer Position verholfen hat – ihr Erfolg baut in der Tat auf der differenzierten Art auf, wie sie dieses Misstrauen zum Ausdruck bringen. Die Vertreter der Kunstperformance gehören da auch dazu. Ist der grosse Erfolg, den die zeitgenössischen Vertreter dieser Zunft erfahren, nicht gerade Beweis dafür, dass ihre Position gleich viel wert ist wie die jener ‚PerformerÂ’, die als die Stützpfeiler der Gesellschaft gelten?“
Als ich mich mit diesem Balanceakt beschäftigte, der der Kunst eine „nachhaltige Performance“ verschaffen will (um corporate-speak zu verwenden), indem sie den Markt überzeugt, dass er auf gleiche Weise profitieren kann, wenn er in diese etwas anders geartete Performance investiert (und sie so am Leben erhält), erinnerte ich mich plötzlich daran, dass ich damals eine Jamesonianische Theorie aufstellen wollte, die aufzeigen sollte, was für Gefahren der kritischen Kreativität drohen, wenn sie vereinnahmt wird – dies zu Zeiten des klassischen Athens bis ins Elisabethanische Zeitalter. Die heutige progressive Sozialkritik in Form von Kunst riskiert wie der Shakespearsche Narr in „King Lear“, der verdammt ist, das Schicksal des Königs, dessen Wahnsinn er kritisiert hat, selbst zu erleiden, nicht nur vereinnahmt zu werden, wenn sie einmal ihr Vermögen in jenem Markt macht, den sie kritisieren will. Sie wird auch unter dem Druck der Eigenkritik schwach gemacht oder vom Gewicht des Molochs, an welchen sie sich gehängt hat, in die Tiefe gezogen. Deshalb muss die Kunst zu betören lernen, sie muss die Welt der Konzerne so weit bringen, dass sie für ihre eigene Verunglimpfung bezahlen. Sie muss dabei abgehoben genug bleiben, um nicht der Heuchelei bezichtigt zu werden, und auch unabhängig genug, um nicht in jener Nacht, „die weder mit Gescheiten noch mit Narren Mitleiden hat“, zusammen mit dem Meister unterzugehen.
(Übersetzt von Adi Blum)